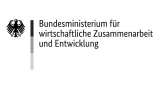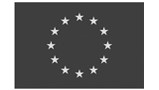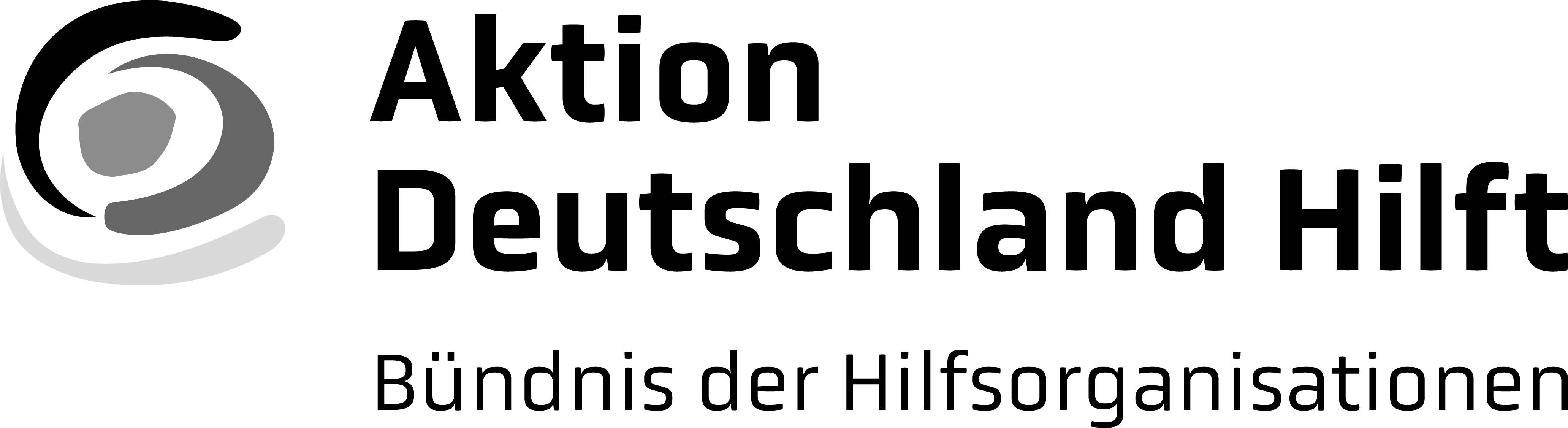Cox's Bazar: "Frauen hier dürfen nur von Frauen medizinisch behandelt werden"
World Humanitarian Day 2019: Habiba Mohamed ist eine unserer #WomenHumanitarians
Schon in jungen Jahren wollte Habiba Mohamed in der humanitären Hilfe arbeiten. Die heute 35-jährige kenianische Ärztin arbeitet seit 2018 als Koordinatorin für Gesundheit und Ernährung für Malteser International in Bangladesch. In Cox’s Bazar, dem größten Flüchtlingslager der Welt, hilft sie bei der medizinischen Versorung der Rohingya-Flüchtlinge. In unserem Interview spricht sie über ihre Erfahrungen, die sie als weibliche Helferin in ihrer internationalen NGO-Laufbahn gemacht hat.
Wie hat Dein Weg Dich in die humanitäre Hilfe geführt?
Ich bin in dem wohl größten Slum der Welt aufgewachsen, Kibera in Nairobi, Kenia. Wir erhielten dort eine kostenlose Gesundheitsversorgung durch Hilfsorganisationen. Diese Ärzte haben mich inspiriert. Sie behandelten die Menschen und waren gut zu ihnen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Die meisten Patienten hätten sich auch nicht leisten können, eine Arztrechnung zu begleichen. Für mich stand von da an fest, dass ich in Zukunft auch benachteiligten Menschen helfen wollte, nicht nur in meinem Land, sondern in der ganzen Welt. Also studierte ich Medizin und ging in den Südsudan, um meine Karriere in der humanitären Hilfe zu beginnen.
Gab es Momente in Deiner Karriere, in denen sich Dein Geschlecht positiv oder auch negativ ausgewirkt hat?
Wenn ich in eine Gesundheitseinrichtung gehe, sind es vor allem Frauen und Kinder, die in der Schlange stehen. Die Frauen bringen ihre kranken Kinder mit, begleiten ihre kranken Angehörigen und betreuen auch die aufgenommenen Patienten.

Da, wo humanitäre Hilfe benötigt wird, sind die Kulturen oft sehr konservativ und das Geschlecht zieht eine deutliche Linie in die soziale Interaktion zwischen Männern und Frauen. Kranke Frauen dürfen oftmals weder von männlichen Ärzten untersucht noch behandelt werden, wenn die Gemeinschaft das Gefühl hat, dass die medizinische Dienstleistung nicht den sozialen Normen ihrer Kultur entspricht. Als Frau habe ich leichteren Zugang zu den Patientinnen als meine männlichen Kollegen. Im vertrauensvollen Kontakt kann mir das helfen, die eigentlichen Ursachen von Problemen zu erkennen, die in der Öffentlichkeit der Gemeinschaft oftmals verschwiegen werden.
Auch hier in Cox Bazar ist es für mich einfacher, mich mit den Patientinnen auszutauschen. Ich kann zum Beispiel die Hütten im Flüchtlingslager betreten, während männliche Kollegen das nicht dürfen, während der Mann des Hauses nicht anwesend ist.
Ich weiß auch, dass sich mein Geschlecht sich in einigen Situationen nachteilig für mich auswirken kann, und dann gibt es nichts, was ich allein dagegen tun könnte. Vermutlich würden meine männlichen Kollegen bei Zusammenstößen oder im Falle eines Hinterhalts eine bessere Verhandlungsposition haben, da Milizen in der Regel kein Interesse an der Meinung einer Frau haben. Eine solche Situation wäre für mich sicherlich nicht der Moment, um auf eine gleichberechtige Behandlung zu bestehen. Ich muss dann einfach versuchen am Leben zu bleiben.

Welche Stereotype ärgern dich oder welche Situationen passieren dir immer wieder, nur weil du eine Frau bist?
Mich stört das Stereotyp von der schüchternen Frau sehr. Weibliche Kollegen halten sich häufig mit ihrer Meinung zurück, weil sie nicht aufdringlich wirken wollen oder weil sie glauben, dass ihre Ideen nicht gut genug sind und dass sie zunächst die Zustimmung ihrer männlichen Kollegen einholen müssen. Als humanitäre Mitarbeiterin aus Afrika habe ich zudem auch manchmal das Gefühl, dass ich doppelt so hart arbeiten muss, um gleichermaßen ernstgenommen zu werden. Während ich in meiner humanitären Laufbahn in sechs Ländern gearbeitet habe (Südsudan, Nigeria, Jemen, Pakistan, Sierra Leone, Bangladesch), habe ich insbesondere bei hochrangingen Meetings Diskriminierung erlebt. Machtdemonstrationen schienen hier wichtiger als eine gemeinsame Agenda. Ich habe auch bereits männliche Kollegen gebeten mich zu solchen Treffen zu begleiten, weil ich wusste, dass ich mir nur aufgrund ihrer Anwesenheit Gehör verschaffen konnte.
In Bangladesch arbeitest Du jetzt mit weiblichen Flüchtlingen zusammen. Wie verbindet Dich Dein Geschlecht mit dem, was sie durchmachen müssen?
Ich bin eine Frau und eine muslimische Frau, wie alle weiblichen Flüchtlinge hier. Das verbindet uns natürlich auf eine gewisse Weise. Uns unterscheidet jedoch, dass meine Eltern mir immer die Freiheit ließen zu wählen, was ich mit meinem Leben machen möchte. Dieses Privileg haben die meisten Frauen hier nicht. Sie müssen Rollenerwartungen ihrer Gesellschaft entsprechen, die sie als Frau benachteiligen und ausgrenzen. Geht eine Frau arbeiten, muss sie damit rechnen, dass sie und ihre Familie bedroht werden. Oder sie dürfen das Haus nur in männlicher Begleitung verlassen – was natürlich umso problematischer ist, wenn der Ehemann oder die Brüder bereits verstorben sind. Ich kenne die gesellschaftlichen Erwartungen an die Frauen, aber zusammen mit meinen bangladeschischen Kollegen versuche ich immer auf diplomatischem Wege Lösungen zu finden, damit die Frauen trotzdem zu einer guten medizinischen Versorgung kommen.

Musstest Du jemals um Dein Leben fürchten? Wie haben Ihre Kollegen in solchen Situationen geholfen?
Als ich im Jemen arbeitete, musste ich einmal um mein eigenes Leben fürchten. Der Boden der Notfallaufnahme war mit Kugeln übersäht. Ich war zu Tode geängstigt, aber wegzulaufen war für mich keine Option. Die verletzten Menschen musste aufgenommen und behandelt werden. Zum Glück hatte ich immer tolle Kollegen, auf die ich auch in gefährlichen Situationen zählen konnte.
Das Umfeld, in dem ich arbeite, ist meistens unsicher. Gewaltausbrüche sind immer möglich und als Frau muss man zusätzlich damit rechnen, Opfer sexueller Übergriffe zu werden. Das ist ein stets präsentes Thema, das mir auch Angst macht. Hilfsorganisationen nehmen die Sicherheit ihrer Mitarbeiter in der Regel jedoch sehr ernst, und vor jedem Einsatz gibt es eine ausführliche Sicherheitseinweisung.
Wie haben andere Frauen Deine Karriere unterstützt?
Viele meiner Vorgesetzten im Südsudan waren Frauen. Ich konnte viel von ihnen lernen, was mich persönlich und beruflich weiterbrachte. Auch hier bei Malteser International arbeite ich mit starken und zuverlässigen weiblichen Führungskräften zusammenzuarbeiten, die mich in meiner Rolle unterstützen und mir die Möglichkeit geben, zur Verbesserung des Teams beizutragen.
Was würdest Du anderen jungen Frauen raten, die eine Karriere in der humanitären Hilfe anstreben?
Als Frau ständig unterwegs zu sein, erfordert Opfer. Aber es kann sehr erfüllend sein, Menschen in Not zu helfen. Geschlechterrollen werden trotz globaler Meilensteine zur Gleichberechtigung immer vorhanden sein. Es gibt Fortschritte, aber wir sind immer noch weit davon entfernt ohne Stereotypen miteinander umzugehen. Als humanitärer Helfer akzeptiert man diese Stereotype besser und arbeitet mit ihnen. Ein Leben als humanitäre Helferin ist nicht einfach, aber es ist ein gut möglicher Weg.
Was bedeutet es für Dich, humanitäre Helferin zu sein?
Humanitäre Helferin zu sein bedeutet für mich, den Dienst über sich selbst zu stellen, Gutes zu tun und Freundlichkeit zu zeigen. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Ich sagte zwar schon oft: „Das wird meine letzte Mission sein“. Aber sobald ich ein paar Monate zuhause in Nairobi verbracht habe, merke ich, dass die Hilfe doch meine Berufung ist. Ich melde mich dann erneut zum Einsatz und packe wieder meine Tasche. In meiner nubischen Gemeinschaft in Kenia ist es für Frauen nicht üblich, die Welt beruflich zu bereisen, aber ich tue das gerne. Das ist mein Ding, und das ist es, was mich nachts gut schlafen lässt.
August 2019, Interview geführt von Michael Etoh, übersetzt von Susanna Cho