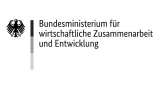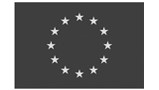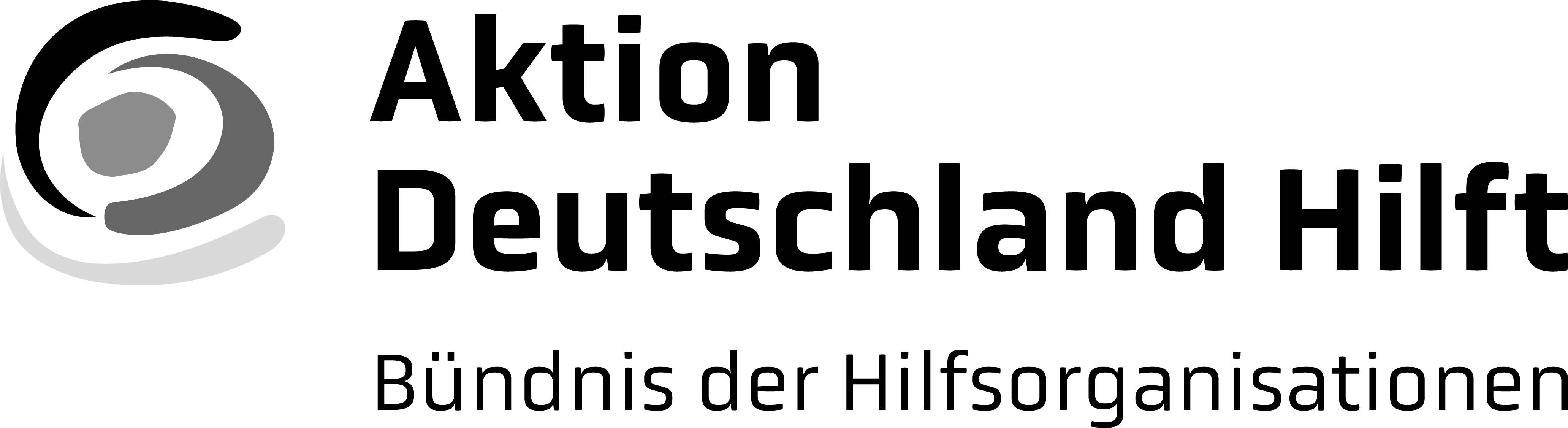„Alles, was in meinem Kopf war, war der Krieg“
Eine Familiengeschichte von Andrea Jeska
Es waren Mandarinen, mit denen er ihr Herz gewann. Den Mann, der sie ihr schickte, kannte sie nur über Facebook. Sie hatten ein paar gemeinsame Freunde und schrieben sich. Irgendwann erwähnte sie nebenbei, dass sie Mandarinen möge. Am anderen Tag kam ein Bote in das Büro, in dem sie arbeitet, und brachte ihr eine Kiste mit 30 Kilo von den Früchten. Später erfuhr sie, dass die Mandarinen seinen halben Monatslohn gekostet haben.

Die Mandarinen waren der Anfang einer Liebe, in der für Romantik nur wenige Momente blieben. Kaum Zeit, um sich Erinnerungen zu schaffen, für Unbeschwertheit. Ekaterina, genannt Katja, und Alexander, genannt Sascha, aus der ostukrainischen Stadt Pokrowsk fanden zusammen, als ein seit vier Jahren währender Krieg wie grauer Staub auf den Seelen der Menschen lag. Ein Krieg, der 1,5 Millionen Menschen vertrieben hatte, in dem 13.000 gestorben waren und in dem noch heute, sieben Jahre seit seinem Beginn, jede Woche Menschen von Scharfschützen und durch Granaten und Minen getötet werden. Ein Krieg, der im Westen Europas längst vergessen ist, weil die Gewalt nur sporadisch und die Standpunkte festgefahren sind – und weil der Osten der Ukraine weit fort ist. Im internationalen Gebrauch spricht man von einem „eingefrorenen Konflikt“. Doch für jene, die mit ihm leben, ist dieser Krieg so gegenwärtig wie ein Schatten, der immer da ist. Egal, was man tut, egal wohin man flieht.
Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen haben sie geheiratet. Katja, dunkle Haare, große Augen, immer zu einem Lachen bereit. Etwas Warmes und Frohes geht von ihr aus. Und Sascha, schmal, ernst und grüblerisch, mit schwermütigen Augen. Sie waren eigentlich noch zu jung, sie 20 Jahre alt, er 22. Aber er war bereits an der Front und sie hatte Angst, er käme nicht wieder. Für die Hochzeit erhielt er ein paar Tage Urlaub. Sie wurde schwanger, er rief sie jeden Tag an, aber sie sahen sich nicht. Monatelang. Immer sagte er, es ginge ihm gut, es gebe nichts Besonderes zu erzählen.
Als der Sohn geboren wurde, löste er seinen Vertrag und kam nach Hause. Sie sei so glücklich gewesen. Weil er überlebt hatte. Weil sie nun eine Familie waren.
Von der Liebe im Krieg
Es ist Spätfrühling in der Stadt Pokrowsk und in allen Gärten und Parks blühen rote Tulpen, ein wahres Meer leuchtender Kelche. Sie sind fast das Schönste an der Stadt, neben den vielen Kastanienbäumen und Ulmen, die die Straßen säumen. Im Jubilejnii Park in der Mitte der Stadt spazieren Familien mit ihren Kindern, sie halten rosa Zuckerwatte und Luftballons in den Händen, die Eisbuden sind umlagert und über die Wege laufen Jogger. Katja, Sascha und ihr inzwischen zweijähriger Sohn Zachar spielen auf einer Wiese. Der Kleine ist schnell und abenteuerlustig, immer wieder entwischt er den Eltern, pustet die Sporen vom Löwenzahn und läuft Slalom um die Bäume. Katja und Sascha jagen ihn abwechselnd, lassen sich mit ihm schließlich erschöpft ins Gras fallen. Wer sie beobachtet, sieht drei fröhliche Menschen.
Katja: Noch vor ein paar Monaten wäre so ein Ausflug nicht möglich gewesen.
Sascha: Ich konnte nicht unter Menschen sein. Es machte mir Angst.
Katja: Du konntest nicht einmal Bus fahren.
Sascha: Alles, was in meinem Kopf war, war der Krieg. Ich konnte mit dem zivilen Leben nichts mehr anfangen. Ich sah überall nur Feinde.
Katja: Auch in mir und unserem Kind.
Wenn eine Liebesgeschichte auch eine Kriegsgeschichte ist, dann handelt sie von der Liebe im Krieg. Oder vom Krieg in der Liebe. Für Katja und Sascha war es erst das eine, dann das andere. Denn Saschas Rückkehr war nicht das erhoffte Glück. Er lebte, ja, er war unverletzt, zumindest äußerlich.
Katja: Er war mir fremd.
Sascha: Ich war mir selber fremd.
Katja: Du hast nicht geredet. Nachts hast du im Schlaf geschrien.
Sascha: Ich fand keine Arbeit. Wir hatten kaum Geld. Und ich fühlte mich immer noch wie ein Soldat an der Front: ohne Sinn und Zugehörigkeit.

Irgendwann wurde Sascha aggressiv gegen sie, ungeduldig und laut. Sie bat ihn, sich Hilfe zu holen. Er lehnte ab. Da ging sie allein zu einer Psychologin und redete sich alles von der Seele. Wie einsam sie ist, wie überfordert: das Baby, die Geldsorgen und dieser fremde, schweigende Mann. Der von Gespenstern umgeben war, die ihr Angst machten. Der den Krieg nicht hinter sich ließ, sondern mit in ihr Leben brachte. Erzählte auch von ihren Eltern, die auf Seiten der Separatisten stehen, mit denen sie nicht mehr frei reden könne, weil es immer nur Streit gäbe. Darüber, ob der Osten der Ukraine, die Donbass-Region, nicht lieber zu Russland gehören sollte. Ihr Sascha, der sei doch überzeugter Ukrainer und sie selber wolle auch zum Westen gehören.
Katja: Es tat schon gut, es alles einmal auszusprechen. Und auch zu sagen; ich schaff das nicht, alleine kann ich das nicht.
Sascha: Ich konnte das damals nicht. Ich hatte keine Worte für meine Gefühle.
Wir lernen Katja kennen, als sie eine ihrer Therapiestunden hat. Irgendwo in Pokrowsk steht ein Gebäude, in dem Malteser International psychosoziale Unterstützung für „die Betroffenen des Konflikts in der Ukraine“ anbietet. Für Kinder mit Alpträumen und Panikattacken, Soldaten mit posttraumatischen Belastungen, Selbstmordgedanken, Frauen mit Depressionen, deren Männer an ihnen ihre Hilfslosigkeit, Arbeitslosigkeit, ihre Kriegserinnerungen und ihre Wut auslassen. Die Kurve der häuslichen Gewalt und auch des sexuellen Missbrauchs ist seit Beginn des Krieges dramatisch angestiegen. Dazu Alkohol-, Drogen- und Spielsucht, Arbeitslosigkeit, Armut. Auch, wenn das Leben in Pokrowsk einigermaßen sicher ist, in der Wahrnehmung ist es das nicht. Die meisten von denen, die psychologische Hilfe suchen, sind aus den Kriegsgebieten geflohen, haben Heimat und oft genug Angehörige verloren. Auf Pokrowsk fallen keine Mörsergranaten mehr, doch die Stadt, Tor zum Donbass, wird in dritter Linie verteidigt. Was bedeutet, käme es zu einem Einmarsch russischen Militärs, würde auch dort gekämpft.
Die Front zieht sich auch durch die Familien. Die einen sind pro-russisch, die anderen pro-ukrainisch, die einen glorifizieren die Sowjetunion, die anderen wollen Zugehörigkeit zur EU. Für die einen sind die Separatisten Verbrecher, für die anderen Helden. Und immer ist die Gefahr gegenwärtig. „Die Russen und die Separatisten sind nicht hier, aber sie können jeden Tag hier sein“, ist ein oft geäußerter Satz. Über diesen politischen Ideologien sind Ehen zerbrochen und haben sich Eltern von ihren erwachsenen Kindern abgewendet.
Unsere Unterstützung in der Ukraine

Das psycho-soziale Projekt der Malteser existiert seit 2015 und beschäftigt in Pokrovs 10 psychologische Fachkräfte. 250-300 Menschen bekommen dort jedes Jahr Unterstützung, die meisten durch Verhaltenstherapie. Die jüngste Patientin war zwei Jahre alt, die älteste 80 Jahre. „89 Prozent unserer Patienten fühlen sich nach einer dreimonatigen Therapie in der Lage, wieder im Alltag zu bestehen und ihre Probleme zu lösen“, sagt die Leiterin des Zentrums, Viktoria Solowyova. „Die anderen überweisen wir weiter an Psychotherapeuten.“
Fast ein Jahr lang hat Sascha sich geweigert, Hilfe anzunehmen. Und dann eines Abends sagte er plötzlich: Gut, lass uns zusammen zum Therapeuten gehen.
Sascha: Ich habe verstanden, dass mit mir etwas nicht stimmt und ich meiner Familie schade. Ich konnte meine Aggressionen nicht kontrollieren. Katja: Ich konnte dir nicht helfen, ich war an der Front nicht dabei. Ich hatte keine Ahnung, wie es ist, aber du warst voll davon.
Sascha: Ich war so einsam, weil da niemand war, mit dem ich meine Erfahrungen teilen konnte.
Katja: Als Sascha im Krieg war, habe ich von Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“ gelesen. Damit ich verstehe, was Sascha durchmacht. Das Buch hat mir Angst gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, dadurch bin ich meinem geliebten Sascha nahe.
Sascha: Der Krieg war viel schlimmer als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich dachte, ich hätte mich vorbereitet, aber die Realität war dann eine ganz andere.
Die ständige Kriegsgefahr ist für Katja und Sascha nur schwer zu ertragen

Als die Ukraine 1991 unabhängig wurde, waren Katja und Sascha noch nicht geboren. Sascha verbrachte seine Kindheit und Jugend im Westen des Landes, in der 800 Kilometer von Pokrowsk gelegenen Stadt Winiza, Katja in Donezk, dicht an der russischen Grenze. Als die Separatisten die Stadt eroberten, floh Katja 2014 mit ihrer Familie, um dem Beschuss mit Mörsergranaten zu entkommen. In Pokrowsk fanden sie ein neues Zuhause. Katja beendete die Schule, begann als Bankangestellte zu arbeiten. Für Sascha in Winiza war der Krieg keine Realität, sondern nur Schlagzeilen in den Medien. Aber er hatte einen patriotischen Freund, der ihm immer wieder sagte, die Ukraine müsse verteidigt werden. Also meldete Sascha sich freiwillig und wurde in den Osten in die Hafenstadt Mariupol versetzt. Was genau ihn bis in den Schlaf verfolgt, will er nicht sagen. Nein, er habe keinen der anderen Soldaten sterben sehen. Aber der Tod sei doch stets gegenwärtig gewesen. Mit jeder Mörsergranate, mit jedem Schnellfeuer.
Es war für Sascha keine Überraschung, als in der Therapie ein Posttraumatisches Belastungssyndrom diagnostiziert wurde. Er hatte diese Zustände bei anderen Soldaten gesehen. Die Panikattacken aus heiterem Himmel. Die plötzliche Wut. Die Lethargie und die Freundlosigkeit. Er hatte gesehen, wie diesen Männern das Leben auseinanderbrach.
Sascha: Ich wollte das nicht. Da war meine Frau, die auf mich gewartet hatte, da war mein Kind. Ist nicht mehr Sinn darin, ein Vater zu sein. Was ist ein Soldat? Am Ende ein einsamer Mann in einem einsamen Kampf.
Würde er sich noch einmal an der Front einsetzen lassen. Die Antwort kommt ohne Zögern. „Ja. Es war richtig, die Ukraine zu verteidigen, für die Freiheit zu kämpfen. Aber es ist auch richtig, damit wieder aufzuhören."
Der Tag geht zu Ende. Sascha und Katja zeigen uns das Mietshaus, in dem sie wohnen. Die Fassade bröckelig, der Balkon vor ihrem Wohnzimmerfenster hängt gefährlich schief. Sie wollen nur das Nötigste reparieren lassen, denn eigentlich möchten sie fort aus Pokrowsk und in Saschas Heimat Winiza ziehen. Dort aber ist das Leben teuer, die Mieten viel höher als im Osten. Andererseits glauben sie, die ständige Kriegsgefahr nicht mehr zu ertragen. „Da ist immer diese Frage in deinem Kopf: Was ist, wenn…? Wir haben alle Dokumente in einer Tasche, einen gepackten Notfallkoffer und wir tanken unser Auto stets voll,“ erzählt Katja.
Ihre Träume sind in weite Ferne gerückt, aber sie sind wieder eine Familie

Katja will in der Abenddämmerung noch ein wenig spazieren gehen. Zachar hat mittags lange geschlafen und ist putzmunter. Während über Pokrowsk die Sonne untergeht, füllen sich die Straßen mit jungen Menschen. In Gruppen, mit Kaffee-to-go-Bechern in der Hand, auf Bänken sitzend, erwecken sie den Eindruck einer ganz normalen Jugend in einem ganz normalen Land. Nur an den vielen Alkoholikern, an Menschen, die vor sich hin brabbelnd über das Pflaster schlurfen, sieht man, dass der Preis für die Normalität der einen der Wahnsinn der anderen ist. „Keiner von uns kann nur im Ausnahmezustand leben“, sagt Katja. Seit Sascha in Therapie sei und keine Angst mehr vor anderen Menschen habe, wolle er nachholen, was er verpasste, deshalb seien sie viel unterwegs. „Sich auf die Familie und die kleinen alltäglichen Dinge zu konzentrieren, macht uns stark.“
An einem Spielplatz machen wir Halt. Zachar spielt gleich im Sandkasten, Sascha und Katja schmiegen sich auf einer Bank aneinander. Sind Menschen, die in einem Kriegsgebiet leben, das, was der Krieg aus ihnen macht? Oder bleibt man im tiefsten Innersten davon unverändert?
Katja: Ich habe früher so gerne russische Literatur gelesen. Tolstoi, Achmatowa, Lermontow. Jetzt kann ich das nicht mehr, obwohl russisch die Sprache ist, mit der ich aufgewachsen bin, die ich immer noch spreche.
Sascha: Aus mir hat der Krieg einen anderen gemacht.
Was hätten sie für ein Leben, wenn es den Krieg nicht gäbe?
Sascha: Ich wollte früher Kosmonaut werden. Aber daraus wäre wohl ohnehin nichts geworden.
Katja: Ich wollte immer reisen, die ganze Welt sehen. Aber eines Tages werden wir das auch tun. Ich, Sascha und der Kleine.