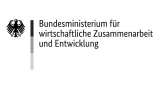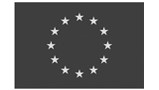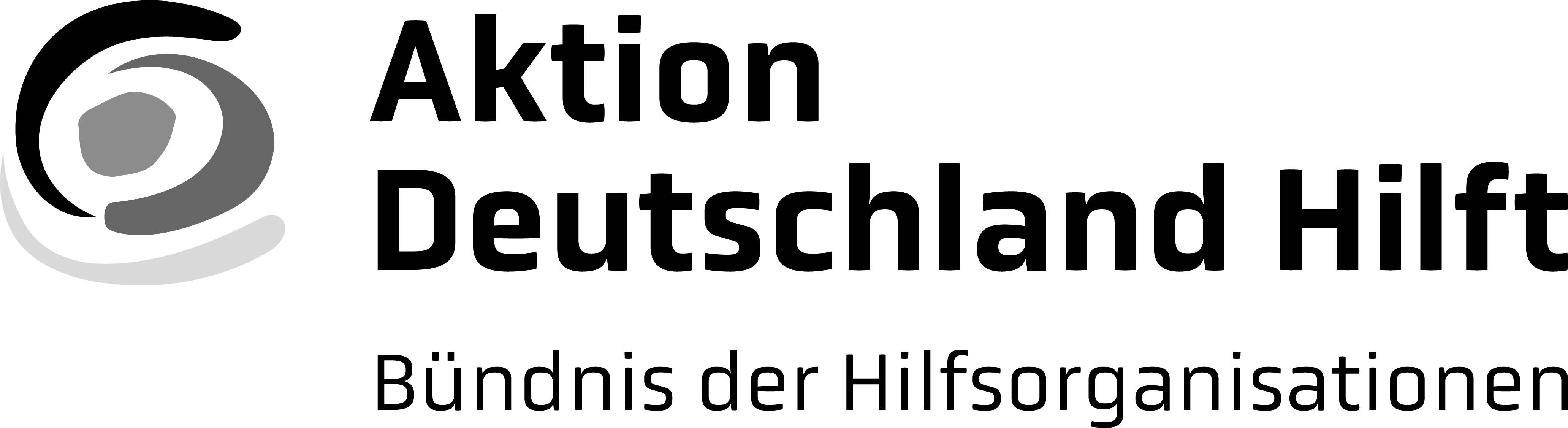Oksana Khmelnytska, Helferin in der Ostukraine: „Wenn man verwandte Seelen findet, kann man Vieles voran bringen – egal wo.“
Oksana Khmelnytska, 47 Jahre alt, ist Traumatherapeutin und Projektkoordinatorin bei unserer Partnerorganisation „Psychologischer Krisendienst“ in der Ukraine. Für Malteser International leitet sie vor Ort ein Projekt zur psychosozialen Unterstützung der Menschen, die unter den Folgen des Krieges im Osten der Ukraine leiden. Im Interview berichtet sie, wie es den Menschen in der Ukraine heute geht, und welche Herausforderungen insbesondere die aus den Konfliktgebieten Geflüchteten im Alltag zu meistern haben.

Oksana, wie lange arbeiten Sie schon in dem Projekt zur psychosozialen Unterstützung vom Krieg traumatisierter Menschen? Wie geht es den Betroffenen heute?
Oksana: „Ich bin seit März 2015, also seit Projektbeginn, dabei. Auf den ersten Blick ist die Situation mittlerweile natürlich weniger akut. Manches im Umfeld der Menschen hat sich stabilisiert: Die Ukraine hat eine Regierung und auch eine reguläre Armee, das Durcheinander der ersten Tage nach dem Majdan hat sich gelegt. Auch das Netzwerk aus Hilfsorganisationen hat sich mittlerweile besser organisiert und etabliert.
Nach außen sieht es also so aus, als sei alles schon vieles besser geworden. Nur für die Menschen im Osten der Ukraine, die direkt an der sogenannten ‚Kontaktlinie’ leben, also dicht am Gebiet der Separatisten, hat sich wenig verändert. Sie leiden noch immer unter völlig unvorhersehbaren Beschüssen und wissen nie, was als nächstes kommt.“
Wie verändert sich die soziale Situation im Land?
„Die Familie ist in der Ukraine immer die erste Instanz gewesen, um Probleme aufzufangen. Heute sehen wir, dass die Familien überfordert sind. Früher war die Familie eine stabile Basis für alle. Jetzt gibt es plötzlich Konflikte um ganz existentielle Fragen: Bleiben wir im Konfliktgebiet oder geben wir alles auf? Ein Teil der Familie will gehen, die anderen wollen bleiben. Die Menschen sind verunsichert, haben keine Zukunft vor Augen und leben im Nirgendwo. Dann kommt ein neuer Beschuss und am nächsten Morgen fragt die Familie sich, ob sie das Haus nochmals reparieren soll oder besser ganz weggeht. Das ist schwer auszuhalten.
Wir sehen viele zerrissene Familien: In einigen Fällen sind die Männer im Separatistengebiet geblieben und haben vielleicht auch auf dieser Seite gekämpft. Die Frauen haben sich mit den Kindern in Sicherheit gebracht, zum Beispiel nach Kiew. Da werden sie natürlich nicht akzeptiert sobald bekannt ist, dass der Mann ,drüben' geblieben ist. Irgendwann wollen sie zurück und oftmals sind die Kinder dann in einem Loyalitätskonflikt zwischen beiden Welten aufgewachsen. Wie soll das ein Teenager einordnen können? Meistens sind es die Frauen, die die Familie irgendwie zusammenhalten und gleichzeitig mit der eigenen Unsicherheit und den eigenen Kriegserfahrungen fertig werden müssen.“


Wie äußern sich diese Erfahrungen konkret? Mit was für Problemen kommen die Menschen zu den psychosozialen Diensten?
„Bei den Menschen, die dicht an der Kontaktlinie leben, die sie übrigens ganz offen ‚Frontlinie’ nennen, sieht man zwei verschiedene Phänomene. Die eine Gruppe reduziert das gesamte Leben aufs Überleben, geht kaum noch aus dem Haus, vermeidet Austausch und zieht sich zurück. Die andere Gruppe wird hyperaktiv, sucht Beschäftigung, macht ständig irgendetwas. Diese Menschen haben aber trotz dieser Ruhelosigkeit kein Ziel, weil sie der Situation nicht entfliehen können. Unser Projektansatz kann den Menschen keinen Waffenstillstand und keine globale Lösung bieten. Wir versuchen den Menschen zu zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Dazu gehört erst einmal zu verstehen, was überhaupt mit ihnen los ist. Die Menschen wissen sehr wenig über psychologische Zusammenhänge und darüber, was Krieg und traumatische Erlebnisse mit ihnen machen. Wir zeigen ihnen Alternativen zu Alkohol, Aggression und Selbstzerstörung.
In den kleinen Orten fernab der Städte arbeiten wir mit mobilen Teams. Wir leisten psychologische Erste Hilfe und versuchen, die Menschen erst einmal zu stabilisieren. Anschließend benötigen sie Strategien, wie sie die Situation aushalten können, ohne daran zu zerbrechen. Es gibt viele Studien, die belegen, dass die psychische Belastung weiter zunimmt, wenn Kriegsbelastungen und -traumata nicht behandelt oder wenigstens offen besprochen werden. Ohne Unterstützung sind die Menschen später kaum noch in der Lage, friedlich zusammenzuleben. Hinzu kommt, dass psychische Probleme an die nächste Generation weitergegeben werden.
Es gibt momentan kein staatliches System, das die Menschen auffangen könnte. In der Ukraine sind viele Dinge noch im Umbruch und Neuaufbau. Auch das Gesundheitssystem hat noch viele Reformschritte vor sich und es mangelt an Kapazitäten. Wir können staatliche Leistungen nicht ersetzen, sondern springen in eine Versorgungslücke ein, damit die Menschen nicht verzweifeln.“
Arbeiten wir auch im Separatistengebiet?
„Aus bürokratischen Gründen können wir dort leider nicht arbeiten. Allerdings haben wir in den psychosozialen Zentren auch Patienten, die im Separatistengebiet leben und zwischen den Seiten pendeln. Die Zentren sind für alle offen.“
Worauf in diesem Projekt sind Sie besonders stolz?
„Da fallen mir spontan zwei Dinge ein, die mir wirklich wichtig sind. Zum einen haben wir als Team in der vergangenen Jahren sehr viel während unserer Arbeit gelernt und uns weiterentwickelt. Malteser International hat immer viel Vertrauen in uns gesetzt und uns auch die Möglichkeit gegeben, verschiedene Ansätze auszuprobieren. Dadurch hatten wir viel Verantwortung, an der wir gewachsen sind. Wir haben international anerkannte Methoden eingeführt. Malteser International ist eine Organisation mit einer langen Tradition und viel größer als wir. Trotzdem haben wir uns immer als Partner auf Augenhöhe gefühlt. Das gibt uns das Gefühl, dass wir nicht nur Partner, sondern Teil einer großen Organisation sind.
Zum anderen freue ich mich, die Möglichkeit zu haben, mit den Menschen, zu arbeiten und sie besser kennenzulernen. Von Kiew aus ist der Osten der Ukraine weit weg und die Menschen sind uns etwas fremd. Aber wir haben Menschen gefunden, die die gleichen Werte haben wie wir, auch wenn sie zum Beispiel Russisch sprechen, und die immer weiter machen, viel arbeiten und unbedingt etwas für ihre Region oder ihren Ort tun wollen. Heute weiß ich, wenn man verwandte Seelen findet, kann man vieles voran bringen – egal wo.
Wenn ich heute auf das gesamte Projekt zurückschaue, kann ich sagen, dass es ja auch ein Stück meines Lebens ist. Und ich muss sagen: Es ist ein gutes Stück. Wer weiß, was ich sonst mit dieser Zeit angefangen hätte. In der gegebenen Situation ist es das Beste, was wir tun konnten.“
(Juni 2019)