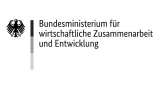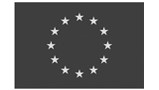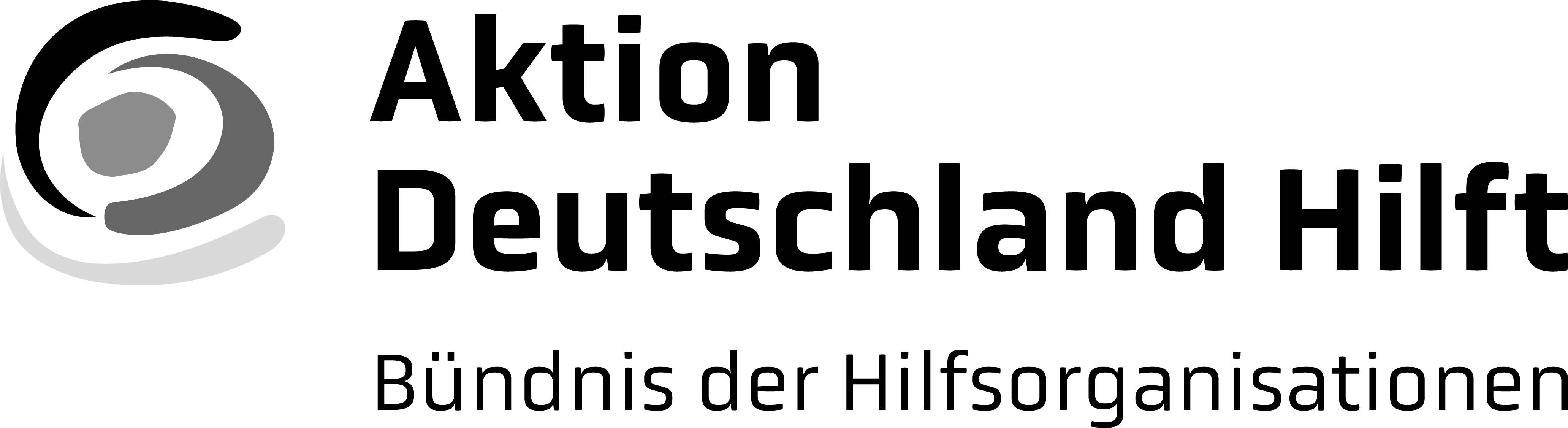Es ist fast, als wäre das Erdbeben gerade erst geschehen
Unsere Pressereferentin Katharina Kiecol reiste gemeinsam mit Mitarbeitenden unserer Nahost-Abteilung für einige Tage in die türkisch-syrische Grenzregion, die 2023 von dem schweren Erdbeben erschüttert wurde, und spricht mit Betroffenen in Syrien. Sie möchte wissen: Wie ist die Lage dort? Wie geht es den Menschen heute? Und kommt unsere Unterstützung an?

Es fühlt sich seltsam an, als wir an der türkisch-syrischen Grenze stehen und plötzlich die Erde unter unseren Füßen bebt. Ganz leicht, aber doch spürbar – als wollte uns die Natur daran erinnern, warum wir hier sind. Zum Zeitpunkt unserer Reise ist das schwere Erdbeben hier in der Grenzregion fast ein Jahr her. Ein Erdbeben, bei dem fast 60.000 Menschen starben und Millionen mehr ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren.
Es ist das erste Mal, dass ich nach Syrien reise. Ich habe viele Gespräche mit Menschen geführt, die aus Syrien in Nachbarstaaten oder nach Deutschland geflohen sind. Doch wie sieht es für die Menschen aus, die vor Ort blieben?
Etwa 30 km hinter der Grenze liegt die Stadt Afrin, eine der vom Erdbeben am stärksten betroffenen Ortschaften. Der langandauernde Krieg hatte bereits viele Veränderungen gebracht: Vor 2011 lebten hier rund 35.000 Menschen, inzwischen sind über 450.000 Vertriebene dazugekommen. Die Straßen sind überfüllt und ich habe fast den Eindruck, als sei das Erdbeben gerade erst geschehen. Denn noch immer stehen rechts und links der Straßen Ruinen. „Es gibt niemanden von den vorherrschenden Gruppierungen, der sich für einen Wiederaufbau zuständig fühlt“, erklärt Dr. Mahmoud Mustafa, Leiter der syrischen Hilfsorganisation IDA (Independent Doctors Association), unserem Partner vor Ort.
Ein Krankenhaus aus Zelten

Auf unserer Fahrt werden wir von IDA-Mitarbeitenden begleitet, denn ohne sie wäre unsere Einreise nicht möglich. Unser erstes Ziel ist das Feldkrankenhaus in Afrin, dessen Aufbau Malteser International mit finanziert hat und das von IDA betrieben wird. „Als das Erdbeben passierte, gab es nur ein Krankenhaus für die ganze Stadt. Viele kleinere Gesundheitseinrichtungen wurden zerstört. Es musste schnell eine Alternative geschaffen werden“, sagt Dr. Mustafa.
Riesige Zelte stehen im Feldkrankenhaus dicht an dicht und es herrscht reges Treiben. In allen Räumen sitzen Patientinnen und Patienten und warten. Auch wenn um uns herum nur Zeltwände sind, gibt es im Feldkrankenhaus fast alles, was für die Untersuchungen benötigt wird: unter anderem zwei Operationsräume, ein CT-Gerät und Röntgenapparate.
In einem abgetrennten Behandlungsraum treffe ich den Arzt Dr. Hasan Wazaz. Ich frage ihn, wie er das Erdbeben damals erlebt hat und wie er die Situation heute sieht, und er beginnt zu erzählen: „Ich hatte zunächst keine Vorstellung, welches Ausmaß dieses Erdbeben hatte. Ich kam ins Krankenhaus, und dort war es völlig überfüllt. Ständig kamen Krankenwagen und brachten mehrere Verletzte gleichzeitig. Heute leben die meisten Betroffenen in Afrin noch immer in Zelten, weil ihre Häuser zerstört wurden. Und das ist im Winter eine große Herausforderung, denn es ist kalt und die Menschen haben nicht genug Geld, um zu heizen. Das ist vor allem für die Gesundheit der Kinder gefährlich. Zusätzlich sind die Menschen in Afrin mehr oder weniger schwer traumatisiert. Ich habe eine 21-jährige Patientin, die beim Erdbeben ihren Mann und ihren Bruder verlor. Sie lag tagelang unter den Trümmern und brach sich den Rücken und ein Bein. Wie soll sie das Erdbeben je vergessen?“
Noch immer leben 40.000 Menschen in Notunterkünften

Einige Kilometer entfernt, in der Nähe der Grenzstation Bab al Salam, ist das Wassim Maaz Krankenhaus, das wir bereits seit 2015 unterstützen und mit aufgebaut haben. Der Weg dorthin ist mühsam, die Straßen sind kaum befestigt, und immer wieder müssen wir an den Checkpoints halten. Auch hier, wie in Afrin, stehen dicht gedrängt Zelte in der Landschaft: Noch immer leben im Nordwesten Syriens aufgrund des Erdbebens mehr als 40.000 Menschen in diesen Unterkünften, vier Millionen weitere wegen des Krieges. Zahlen, die erst annähernd greifbar werden, wenn ich mir verdeutliche, dass hinter jeder einzelnen ein Mensch und eine Geschichte stehen.
So wie der 40-jährige Muhammed Abdu. Ihn treffe ich im Krankenhaus, wo er kostenlos wegen Bluthochdrucks behandelt wird. Mit einigen Medikamenten in der Tasche macht er sich auf den Heimweg und nimmt uns mit. Er lebt mit vier seiner sechs Kinder und seiner Frau in einem der Camps neben der Klinik. Früher wohnte er in der Nähe von Aleppo, doch gleich nach Kriegsbeginn floh er hierher und brachte sich und seine Familie in Sicherheit. Das war vor fast 13 Jahren. In drei Camps rund um die Klinik leben heute rund 26.000 Menschen. Doch im Einzugsgebiet der Klinik sind es eine Million. Muhammed Abdu zeigt uns, wie das Erdbeben auch sein kleines Zuhause beschädigte. Private Spender, sagt er, haben ihm dabei geholfen, sein Haus zu reparieren, denn in allen Wänden waren tiefe Risse. „Wir sind noch immer traumatisiert. Auch wenn wir alle am Leben sind, haben wir ständig Angst, dass wir nicht sicher sind“, sagt Muhammed Abdu.
Scheinbare Sicherheit wurde zu dauerhafter Angst

Dass Angst und Trauma tief sitzen, höre ich auf meiner Reise immer wieder. Auch als wir zwei Tage später in die Region Idlib fahren. Diese Region wird derzeit von der radikal-islamischen Organisation Hayat-Tahrir-al-Scham kontrolliert. Aus Gründen der kulturellen Sensibilität, aber auch zu unserer eigenen Sicherheit, tragen die Frauen aus unserer Reisegruppe deshalb eine Abaya, ein knöchellanges Kleid, das über der Kleidung getragen wird. Es fühlt sich ungewohnt an, und ich bin nicht so beweglich wie normalerweise.
Hinter der Grenze fahren wir Richtung Süden nach Armanaz. Noch nie habe ich so viele Geflüchteten-Unterkünfte auf so engem Raum gesehen. Und dies, obwohl der Boden so mit Steinen übersät ist, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie hier überhaupt Zelte oder Container aufgestellt werden können. Im Armanaz Surgical Hospital unserer Partnerorganisation HIHFAD (Hand in Hand for Aid and Development) treffe ich Dr. Ibrahim Al-Khatib. Kurz nach dem Erdbeben hatte er uns berichtet, wie schrecklich die Situation im Krankenhaus war. Heute möchte ich wissen, wie es mittlerweile aussieht. „Rückblickend war das Erdbeben das schlimmste, was ich je erlebt habe“, sagt Dr. Al-Khatib. „Die Situation hier war ja schon vor dem Erdbeben schlimm. Hunderttausende waren vor dem Krieg in dieses Gebiet geflohen, weil sie dachten, dass sie hier in Sicherheit leben könnten. Doch dann kam das Erdbeben und viele verloren erneut ihr Zuhause, verloren Familienmitglieder, Freunde. Es hat mich selbst tief im Herzen getroffen und ich war psychisch wirklich angeschlagen“, sagt Dr. Al-Khatib.
Die Menschen in Syrien brauchen weiter unsere Hilfe!
Es wird nur noch wenig über die Situation in Syrien berichtet, denn andere Krisen sind in den Vordergrund getreten. Doch die Angst der Menschen hier ist spürbar. Das Erdbeben im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass die Menschen sich noch ungeschützter fühlen als aufgrund der andauernden Gewalt ohnehin schon, denn die scheinbar sicheren Regionen Idlib und Afrin wurden von jetzt auf gleich für mehr als 7.000 Menschen zur Todesfalle.
Ich fahre mit gemischten Gefühlen nach Hause. Auf der einen Seite haben wir erlebt, dass unsere Unterstützung vor allem im medizinischen Bereich mit gut ausgestatteten Kliniken bei den Menschen ankommt. Aber auf der anderen Seite war überdeutlich, wie groß die Not ist, wie viel noch lange Zeit gebraucht werden wird, und wie wichtig es ist, dass wir die Menschen in Syrien nicht vergessen. Ich habe sie auf jeden Fall tief in meinem Herzen und bin sehr dankbar, dass sie so offen mit mir gesprochen haben und ihre Geschichten mit mir teilten.
(Katharina Kiecol, Januar 2024)